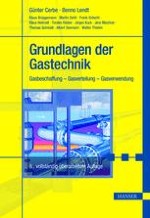2017 | Buch
Grundlagen der Gastechnik
Gasbeschaffung – Gasverteilung – Gasverwendung
verfasst von: Günter Cerbe, Benno Lendt, Klaus Brüggemann, Martin Dehli, Frank Gröschl, Klaus Heikrodt, Torsten Kleiber, Jürgen Kuck, Jens Mischner, Thomas Schmidt, Albert Seemann, Walter Thielen
Verlag: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG