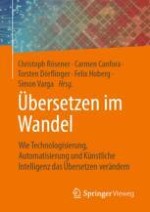Der Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft (FTSK) Germersheim der Johannes Gutenberg-Universität Mainz feierte im Jahr 2022 sein 75-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum nahm der Germersheimer Arbeitsbereich Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft sowie Translationstechnologie (ASTT) zum Anlass, im Rahmen einer Tagung 2022 einen Blick nicht auf die Vergangenheit, sondern die Zukunft des Übersetzerberufs zu werfen. Im Zentrum des Interesses standen dabei die Auswirkungen, die der Übersetzerberuf und die Übersetzerausbildung im Zuge des digitalen Wandels erfahren, der insbesondere in Gestalt der Maschinellen Übersetzung und der fortschreitenden Automatisierung von Übersetzungsprozessen die Branche zunehmend prägt.
Welche Kompetenzen müssen Studierenden heute vermittelt werden, damit sie in der Berufswelt von morgen ihren Platz finden? Wie kann man sie mit einer positiven Haltung dem digitalen Wandel gegenüber ausstatten und ihnen somit eine aktive Rolle in diesemSystem ermöglichen?