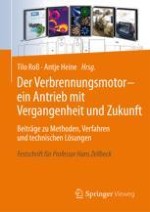2018 | Buch
Der Verbrennungsmotor - ein Antrieb mit Vergangenheit und Zukunft
Beiträge zu Methoden, Verfahren und technischen Lösungen Festschrift für Professor Hans Zellbeck
herausgegeben von: Dr. Tilo Roß, Prof. Dr. Antje Heine
Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden