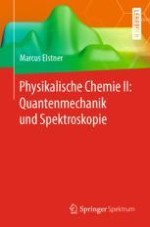2021 | OriginalPaper | Buchkapitel
4. Die Schrödinger-Gleichung
verfasst von : Marcus Elstner
Erschienen in: Physikalische Chemie II: Quantenmechanik und Spektroskopie
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.
Wählen Sie Textabschnitte aus um mit Künstlicher Intelligenz passenden Patente zu finden. powered by
Markieren Sie Textabschnitte, um KI-gestützt weitere passende Inhalte zu finden. powered by