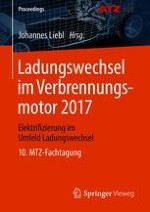2018 | Buch
Über dieses Buch
Die inhaltlichen Schwerpunkte des Tagungsbands zur ATZlive-Veranstaltung Ladungswechsel im Verbrennungsmotor 2017 sind unter anderem die Betrachtung des Gesamtsystems und dessen Optimierung, der Einfluss der Elektrifizierung auf den Ladungswechsel, Brennverfahren, Variabilitäten, Brennstoffzelle, Aufladung sowie neue Entwicklungsmethoden. Die Tagung ist eine unverzichtbare Plattform für den Wissens- und Gedankenaustausch von Forschern und Entwicklern aller Unternehmen und Institutionen.
Anzeige